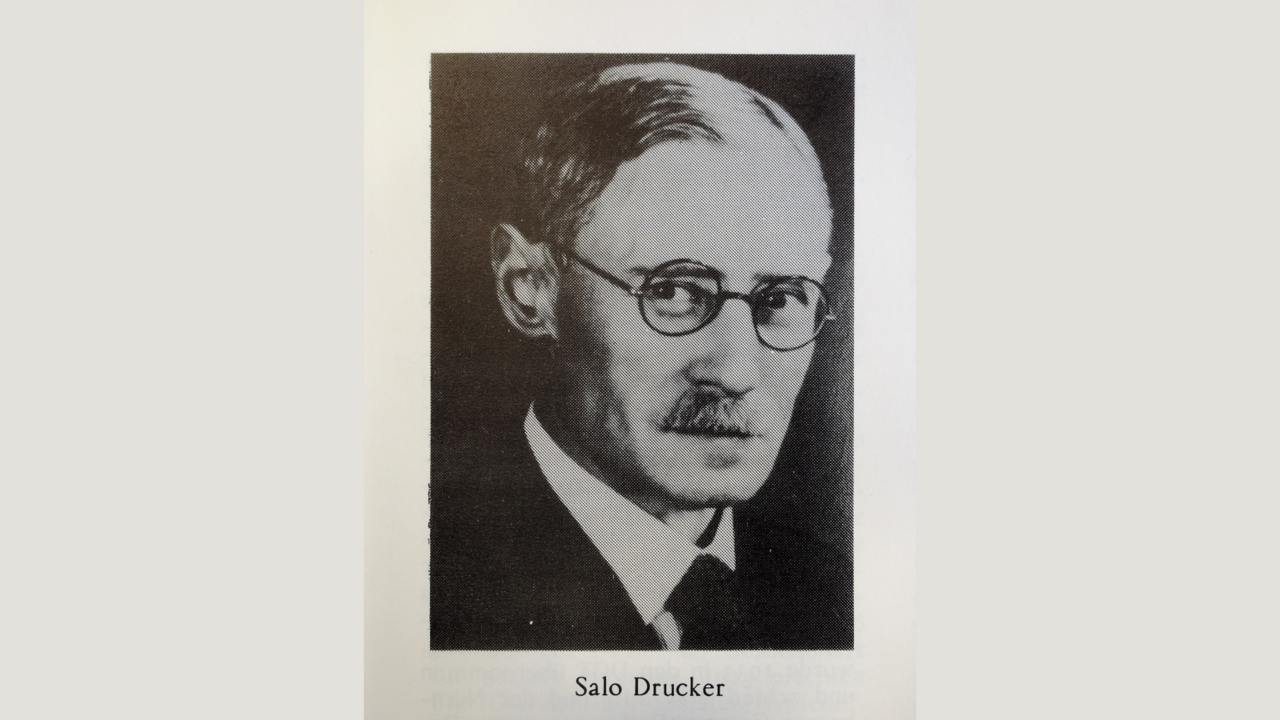Politischer Mediziner
Der älteste von vier Söhnen der jüdischen Kaufleute Hulda und Wolff Drucker wurde am 17. September 1885 im damaligen Lissa, dem heutigen polnischen Leszno geboren. Er besuchte das Gymnasium seiner Heimatstadt, studierte an der Berliner Universität Medizin und promovierte über „Atonia uteri“. 1910 erhielt er seine Approbation als Arzt und arbeitete danach in der Kinderheilkunde. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit engagierte sich Drucker auch politisch. Er trat in die SPD ein, war Jugendhelfer in Arbeiterverbänden und stellte sich dem Zentralbildungsausschuss der SPD als Wanderredner zur Verfügung.
Kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges, am 1. Juli 1914, heiratete Drucker seine Cousine Liesbeth Sachs, die ebenfalls der SPD angehörte. Nach seiner Einberufung arbeitete er als Militärarzt an der Ostfront. Da er die Fortsetzung des Krieges und die Burgfriedenspolitik der SPD jedoch ablehnte, trat er aus der Partei aus und schloss sich der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) an. Später kehrte er wieder in die SPD zurück.
Überzeugter Abstinenzler
Im Jahr 1919 nahm Drucker eine Stelle als Gemeinde- und Schularzt in der damaligen Landgemeinde Berlin-Reinickendorf an. 1922 wechselte er – nun als Stadtarzt – in den Wedding. Neben der Tuberkulosefürsorge baute er dort die Säuglings- und Kleinkindfürsorge sowie die Schulgesundheitspflege aus und initiierte eine Beratungsstelle für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Mit seiner Unterstützung konnte außerdem die erste Beratungsstelle für soziale Kosmetik im damaligen Deutschen Reich gegründet werden. Diese vermittelte ärztliche Hilfe in allen Fällen von körperlichen Entstellungen.
Als überzeugter Abstinenzler leitete Drucker ab 1927 selbst die Beratungsstelle für Alkoholkranke, die eng mit den Wittenauer Heilstätten, der späteren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, zusammenarbeitete. In zahlreichen Publikationen, Vorträgen und Reden bekannte er sich zur sozialistischen Abstinenzbewegung. Seit Anfang der 1920er-Jahre gehörte er dem Vorstand des „Deutschen Arbeiter-Abstinenten-Bundes“ an, dessen Erster Vorsitzender und Schriftleiter er von 1924 bis 1928 war. Drucker forderte unter anderem, die Gelegenheiten zum Alkoholkonsum zu reduzieren.
Wie sieben weitere Berliner Stadtärzte war Drucker Mitglied des „Vereins Sozialistischer Ärzte“, in dem sich Mediziner:innen verschiedener linker Strömungen organisierten. Der Verein vertrat sozialhygienische Konzepte, die die Bedeutung sozialer Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten betonten. Ihre Aufgabe sahen sie vor allem in der Prävention von Erkrankungen.
Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.
Jüdischer „Krankenbehandler“
Nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Drucker aus politischen und „rassischen“ – so der damalige Sprachgebrauch – Gründen im März 1933 beurlaubt. Dies geschah noch bevor die gesetzliche Regelung in Gestalt des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ am 7. April 1933 in Kraft trat. Kurz darauf erfolgte seine Entlassung. Auswanderungsversuche in die Schweiz und später nach England und in die USA scheiterten. Von 1935 bis zum Entzug seiner Approbation im Jahr 1938 führte der ehemalige Stadtarzt eine Privatpraxis an seinem Wohnort in der Fasanenstraße 59 in Berlin-Wilmersdorf. Ab 1939 war er als „Krankenbehandler“ nur noch zur Behandlung jüdischer Patientinnen und Patienten zugelassen.
Wegen der angeblichen Verbreitung von „Greuelpropaganda“ verhaftete die Gestapo Drucker am 11. Juni 1940 und überführte ihn in die Zentrale der Gestapo. Von dort aus wurde er am 14. Juli 1940 in das Konzentrationslager Sachsenhausen transportiert, wo er laut Sterbeurkunde knapp vier Wochen später, am 19. August 1940, im Alter von 54 Jahren an einer „Herdlungenentzündung“ starb. Liesbeth Drucker musste eine Gebühr zahlen, um die Urne mit der Asche ihres Mannes auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beisetzen zu können.
Sie selbst wurde am 27. November 1941 gemeinsam mit 1.052 anderen Berliner Jüdinnen und Juden nach Riga deportiert. Alle Personen dieses Transports wurden noch am Tag ihrer Ankunft, dem 30. November 1941, im Wald von Rumbula, einem Stadtteil von Riga, erschossen. Dieser Tag ging als „Rigaer Blutsonntag“ in die Geschichte ein. Insgesamt wurden an diesem Tag sowie am 8. und 9. Dezember 1941 über 25.000 lettische Jüdinnen und Juden ermordet.
Erinnerungen
Heute erinnern zwei Stolpersteine vor ihrem letzten Wohnort an Liesbeth und Salo Drucker. Das Grab des ehemaligen Stadtarztes auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee ist hingegen schwer auffindbar, da es keine Hinweise auf seinen Namen gibt. Seit September 2024 hängt eine Tafel zur Erinnerung an Druckers Tätigkeit als Weddinger Stadtarzt am Eingang des Jüdischen Krankenhauses in der Iranischen Straße. Dies ist bereits der zweite Standort der Gedenktafel. Sie wurde 1990 am damaligen Weddinger Gesundheitsamt enthüllt und musste aufgrund des Gebäudeabrisses abgehängt werden. Der Verein Gleis 69 e. V. vermittelte den neuen Standort, der zugleich die erste Wirkungsstätte Salo Druckers als Weddinger Stadtarzt war; denn auf dem Grundstück des Jüdischen Krankenhauses befanden sich die ersten Räume des damals neu gegründeten Gesundheitsamtes.
Die Quellen- und Literaturhinweise wurden aus Gründen der Lesbarkeit entfernt. Das vollständig annotierte Typoskript mit den Literaturhinweisen kann bei der Redaktion angefordert werden.