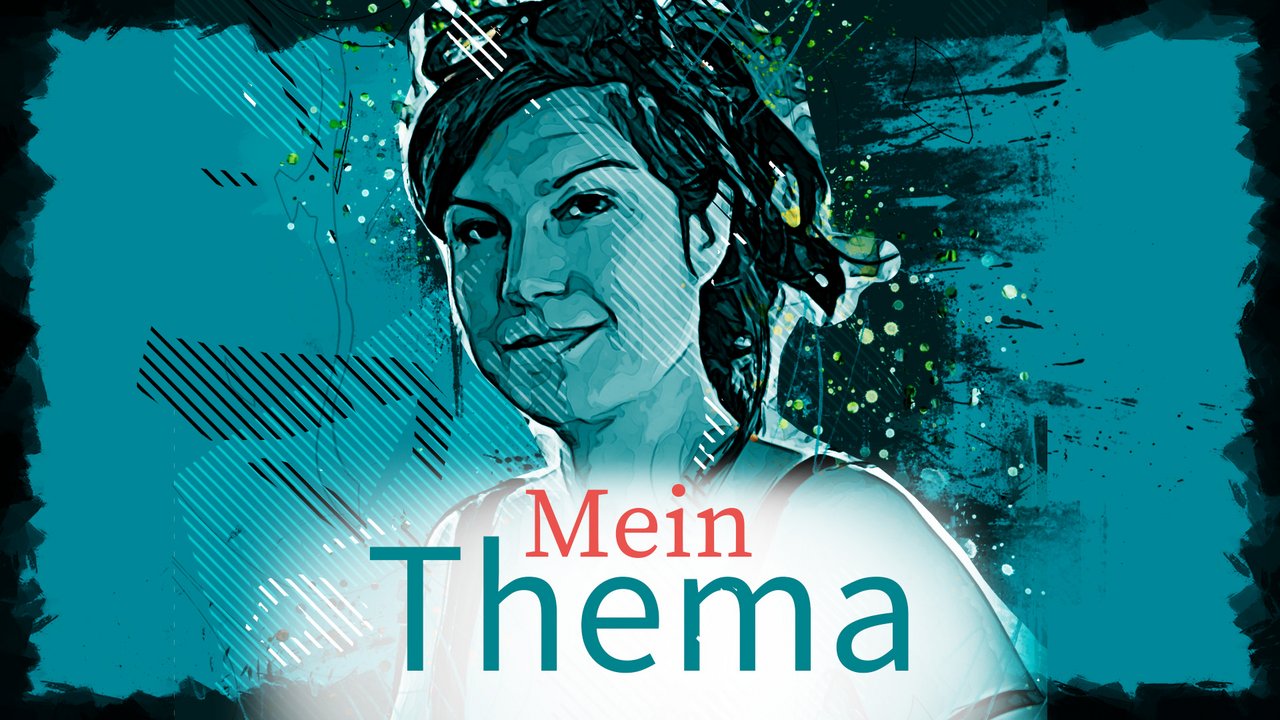Arbeiten in Krisengebieten
Bosnien, Indien, Nepal, Griechenland, Syrien, Irak. Elisa Stein leistete bereits an vielen Orten und in zahlreichen Extremsituationen medizinische Hilfe. Sie erlebte Kriege und ihre schrecklichen Folgen aus nächster Nähe, behandelte Patient:innen in mobilen Kliniken und unterstützte Geflüchtete in Lagern an den EU-Außengrenzen. Überall versorgte sie Menschen, die sich in einer (fast) ausweglosen Lage befanden. Zwar liegt ihre Arbeit in diesen Krisengebieten inzwischen hinter ihr, mit Extremsituationen hat sie es aber weiterhin zu tun. Und mit Menschen, die in einer schier ausweglosen Situation sind – mitten in Deutschland, mitten in Berlin. Ihr aktuelles „Krisengebiet“ heißt in der Sprache der Medizin „Versorgungslücke“.
Versorgung von Menschen mit Post-COVID und ME/CFS
Stein arbeitet seit drei Jahren am Institut der Medizinischen Immunologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Zuvor war sie fast zwölf Jahre lang als Internistin und Notfallmedizinerin in unterschiedlichen Kliniken und im Auftrag verschiedener Hilfsorganisationen tätig. In der Institutsambulanz betreut sie nun im Rahmen von zwei Sprechstunden Patient:innen mit Immundefekten und ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue-Syndrom), forscht zu Post-COVID und ME/CFS und klärt über das Krankheitsbild auf. „Das ist eine sehr herausfordernde, aber auch spannende Aufgabe“, sagt sie. „Denn oft sehe ich meine Patienten nur ein Mal. Ich weiß also, ich habe im Zweifel nur eine Stunde Zeit, um positive Veränderungen auf den Weg zu bringen.“
Obwohl es in Deutschland schätzungsweise 650.000 ME/CFS-Patient:innen gibt, sind nur wenige Ärzt:innen mit dem Krankheitsbild vertraut. Die Fatigue-Ambulanz der Charité ist eine der wenigen Anlaufstellen für Betroffene. Das prägt den Alltag der 42-Jährigen.
Häufig sitzen Menschen weinend vor mir und sagen: ‚Es ist das erste Mal, dass mir jemand wirklich zuhört und mir auch glaubt.‘ Wie traurig ist das eigentlich?
Stein nutzt die Zeit mit den Patient:innen nicht nur, um zuzuhören. In der Ambulanz findet auch Diagnostik statt, die sie auswertet. Außerdem gibt sie Empfehlungen, die die Patient:innen selbst umsetzen können, sowie solche, die sie zusammen mit ihren Haus- und Fachärzt:innen besprechen können. „Wir bieten den Kolleg:innen an, sich mit uns auszutauschen, einige machen das auch.“ Obwohl sie sich darüber freut, weil es den zumeist unterversorgten Patient:innen zugutekommt, weiß sie auch: „Unsere Ressourcen sind sehr begrenzt.“ Das heißt: Die Zeit reicht oft hinten und vorne nicht.
Mehr als Lehrbuchwissen und Leitlinientreue
„Das hat schon Ähnlichkeit zur Arbeit in einem Krisengebiet. Man muss kreativ sein, flexibel und belastbar,“ findet Stein. In dieser Situation kommt man mit Lehrbuchwissen und Leitlinientreue allein jedenfalls nicht viel weiter – auch, weil Post-COVID und ME/CFS kaum erforscht sind. Stein ist deshalb sehr froh, dass sie einen Teil ihrer Patient:innen in Studien einschließen kann, in denen das Institut Behandlungsmöglichkeiten überprüft. So erfährt sie auch, wenn sich deren Zustand verändert.
Wenn sie merkt, dass sie mit ihrer Arbeit helfen kann, ist das auch ein Ausgleich für all die Momente, in denen die Verzweiflung überhandnimmt. Denn nicht alle Ärzt:innen kennen das Krankheitsbild und viele Hausärzt:innen wissen zu wenig darüber; zudem haben sie ohnehin kaum Zeit für ausführliche Gespräche. „Dabei würden diese den meisten Patient:innen enorm weiterhelfen. Es wäre gut, wenn es eine entsprechende Abrechnungsziffer gäbe“, findet die Internistin.
Immer auf dem Laufenden bleiben. Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.
Eigene Privilegien zum Wohle von Hilfebedürftigen nutzen
Was aus ihrer Sicht noch wichtig wäre? Mehr Druck aus der medizinischen Gemeinschaft in Richtung Politik. „Es braucht Netzwerke, in denen sich verschiedene Fachbereiche mit Pflege- und Therapieberufen zusammentun, um multimodale Behandlungskonzepte zu organisieren. Denn es gibt schon einiges, was den Patienten hilft.“ Doch das ist noch zu wenig bekannt. Deshalb stellt das Institut auch Fachinformationen auf seiner Website für Kolleg:innen bereit.
Was hilft Elisa Stein eigentlich, die Herausforderungen in ihrem aktuellen „Krisengebiet“ zu meistern? Zum Ausgleich macht sie Yoga, reist gerne und unternimmt etwas mit Freund:innen, Familie und ihrem Kind – am liebsten in der Natur. Noch bedeutender ist jedoch ihre Demut vor der Aufgabe: „Ich wollte immer die Privilegien, die ich habe, zum Wohl derer nutzen, die sonst keine Hilfe bekommen. Das erfüllt mich. Ich glaube, ich hätte das viele Auswendiglernen im Medizinstudium sonst auch nicht durchgehalten.“
Was beschäftigt Sie?
In dieser monatlichen Reihe fragen wir Berliner Ärzt:innen, was sie bewegt oder antreibt.
Sie haben ein Thema oder kennen jemanden, der hier vorgestellt werden sollte?
Dann schreiben Sie uns per E-Mail an redaktion@aekb.de.